Es begann mit Komödien und Satiren
ES BEGANN MIT KOMÖDIEN UND SATIREN.
Betrachtung zur Verwirtschaftung der DDR im Kino
Die Intervalle zwischen den Filmen, die die verschwundene DDR als Stoff nutzen, vergrößern sich. Schaut man die Filme, wird man kaum so etwas wie die Wahrheit über das Leben in der DDR finden. Aber man kann die Entwicklung eines Geschichtsbildes seit der deutschen Vereinigung nachvollziehen. Das ist allemal ein spannendes Unterfangen. Der aktuelle Streifen „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ beweist es.

Szene aus Go Trabi Go (1991)
Es begann mit Komödien und Satiren. Zu viel gab es über dieses Land und seine Bewohner zu lachen, besonders über die Sachsen. Und sie lachten mit, die Sachsen und die Ostdeutschen in toto. Gleich zu Beginn hatten die westdeutschen Meinungsmacher den Fahrplan vorgegeben für das Erlernen des richtigen Blicks auf ihre Vergangenheit. Umerziehung. Jahrelang war die Öffentlichkeit mit dem Spiel befasst „Sucht den Stasi-Spitzel!“ Und die Ossis spielten brav mit. An irgendjemanden mussten sie ja ihre Frustration über den Gang des Vereinigungsprozesses abreagieren und Schuldige finden. In kaum einem Film kam die Stasi nicht vor (ich kenne keinen einzigen), obwohl sie tatsächlich nur in das Leben weniger Bürger eingedrungen war. Die meisten hatten dieses Sicherheitsorgan nur aus dem Buschfunk gekannt. Eine Umfrage ergab, dass die Westdeutschen den Eindruck bekommen hatten, zwischen 20 und 45 Prozent der DDR-Bevölkerung habe für die Stasi gearbeitet, Offizielle und Spitzel auf der untersten Ebene der Hierarchie zusammengenommen. Tatsächlich lag deren Anteil bei 5 bis 7 Prozent. Auch nicht schön, aber eine ganz andere Nummer.
Die DDR diente also in den 90er Jahren meist als toter Körper, den man ohne auf Widerstand zu stoßen ausweiden konnte und es deshalb auch tat. Das Leben dort ist lächerlich, banal und hinterwäldlerisch gewesen. Auch wenn sie jetzt ins westliche Ausland fahren durften und die Welt kennenlernten: ihr linkisches Auftreten verriet überall ihren Provinzialismus. Die Westdeutschen hätten sich 1990 rund 17 Millionen Spießer ins Land geholt, hörte ich einmal eine schwäbische Frau sagen. Stasi und Biedermeier: eine unschlagbare Kombination, in der Tat.
Ende der 90er Jahre konnte man dann Filme drehen, die einen anderen Blickwinkel einnahmen als den der Verteufelung und des Hohns. Das war die Zeit der Tragikomödien und Dramen. Weichbilder grauer Fassaden und unglücklicher Protagonisten wurden gezeichnet. Melancholie zog ein. Sie fand ihren Ausdruck in Schwarzweißfilmen und ambitionierter Ästhetik. Mit „Wege in die Nacht“ schlug der Regisseur Andreas Kleinert sogar eine Brücke zum film noir.
Der Einzelne im Film
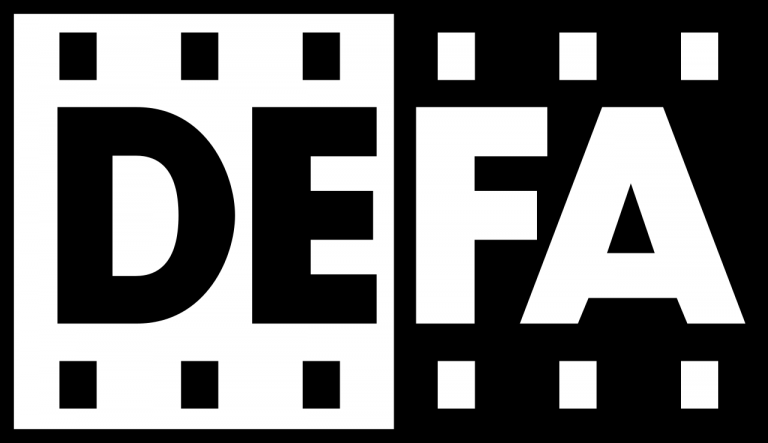
Irgendwann war auf der allgemeinen Ebene alles gesagt, Gesamtentwürfe und -deutungen kamen an ihre Grenzen. Es schlug die Stunde der Einzelportraits. Diese Art, Zeitgeschichte ins Visier zu nehmen, konnte auf eine erfolgreiche DEFA-Tradition zurückgreifen. Man denke an „Berlin um die Ecke“ (1965), „Karla“ (1965), „Spur der Steine“ (1966), „Die Legende von Paul und Paula“ (1973), „Daniel Druskat“ (1976), „Geschlossene Gesellschaft“ (1976), „Hostess“ (1978 ), „Solo Sunny“ (1980), „Das Versteck“ (1978), „Unser kurzes Leben“ (1981) oder „Insel der Schwäne“ (1983).
In differenzierten Portraits von Individuen, die aus der vorgegebenen Rolle des überzeugten Kommunisten herausfielen bzw. durch die erlebte Praxis begonnen hatten zu zweifeln oder bereits zu Zynikern geworden waren, nahmen die Regisseure Tiefenbohrungen vor und demonstrierten so ad hominem, was das Gesellschaftssystem für einzelne bedeutete und wie mit ihnen umgesprungen wurde. Die Filme waren teilweise so direkt und kritisch, dass ihnen die Senderechte entzogen wurden. Manche konnten erst nach der Wende in den Kinos gezeigt werden.
Schaut man sich die genannten DEFA-Filme an, bekommt man den Eindruck, das sozialistische Leben wurde in aller Deutlichkeit und Ehrlichkeit vor dem Zuschauer ausgebreitet. Das stimmt zu einem Teil, zu einem anderen nicht. Ja, die aktuellen Filme thematisierten die Konflikte des sozialistischen Aufbaus. Aber das Portraitieren Einzelner verführte dazu, die Probleme als lösbar im Rahmen der realsozialistischen Gesellschaftsstrukturen zu interpretieren. Alles Aufreibende, Unsinnige, Dogmatische müsse nicht sein, sondern könne behoben werden – wenn alle Menschen aufrichtig, klug, engagiert auftreten würden an den Stellen ihres Wirkens und die alten Denkhüte der vorsozialistischen Zeit – also faschistisches und kleinbürgerliches Denken – konsequent überwunden würden: durch Vorbildwirkung und Aufklärung.
Dass das politisch-ökonomische System Ursache für Absurditäten, Dummheit und Unterdrückung konstruktiven Potenzials sein könnte, dies wurde in keinem DEFA-Film auch nur erwogen. Sei es, dass vorauseilender Gehorsam, also der unbedingte Wille, die Filme zur Aufführung zu bringen – ein selbstverständliches Bedürfnis – obwaltete, sei es, dass die Regisseure von ihrer Botschaft überzeugt waren: man blieb mit dieser Haltung bzw. Praxis an der Oberfläche. Die Kabarettisten durften kritisieren, um den Unmut in der Bevölkerung zu kanalisieren und in harmlose Bahnen zu lenken. Und genauso war es beim Film: Seht her, wir kennen eure Probleme und Ärgernisse, und wir sprechen sie offen an. Aber wir legen die Grenzen fest, bis zu denen eure Kritik als konstruktiv zu bewerten ist. Verletzt ihr diese Grenzen, seid ihr draußen, und wir kümmern uns persönlich um euch. Cancel culture avant le mot.
Das macht die genannten Filme nicht wertlos, aber man muss im Hinterkopf behalten, dass auch die stärkste Polarisierung, die in den Filmen dargestellt wurde, immer eine Lösung erfuhr und Vernunft und Glaube sich durchsetzten. Vernunft, gebrochen durch das Prisma „Glaube“. Und das war das Problem, das nie angegangen aber tabuisiert wurde und letztlich zum Untergang führte. Zum Untergang eines Regimes und der ihm zugrunde gelegten Utopie.
Im Milieu der Modebranche

Der Zeit voraus: Bereits an der Frühjahrskollektion 1990
arbeiten Martina Pohle (l.) und Meisterin
Angela Böhnisch aus der Jugendbrigade
„1. Mai“ der Bekleidungswerke herdas in Greiz im März 1989.
Nach diesem kleinen Exkurs komme ich nun zum neuesten Film über die DDR: „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ von Aelrun Goette. Der Streifen könnte der Beginn eines neuerlichen Paradigmenwechsels in der filmischen oder auch allgemein der fiktiven Bearbeitung des Stoffes „DDR“ sein.
Schon der Titel ist Programm. Wir sehen das letzte Jahr vor der „Wende“ in Berlin im Milieu der Modebranche. Genauer: im Umkreis der Modezeitschrift „Sibylle“. Bereits im Titel klingt (N)Ostalgie an. Man zeigt etwas, eine Nische, die den Eindruck vermittelt, Ostberlin sei ein zweites San Francisco gewesen: lauter hippe junge und mittelalte Künstler, die performten, was das Zeug hält, abgedrehte Kleidung produzierten und Phantasiekostüme trugen, kifften, tranken, sich in Räusche hineinstürzten und der Liebe frönten, dass es eine Art hatte. Sie lebten immer in Gruppen. Ein exzentrischer Schwuler war dabei. Und auf den Einsatz der Stasi wird hier auch nicht verzichtet. Eine junge Frau, der jemand das Buch „1984“ geliehen hat, wurde in die Produktion geschickt, was die Gelegenheit ergab, „abgefahrene Klamotten“ vor dem Hintergrund einer großen Werkhalle abzulichten, und einige authentische Arbeiterinnen gleich mit. Exotik Pur. Man landete auf dem „Sibylle“-Cover und wurde nach Paris zur Modenschau eingeladen.
Kann man machen, ist schön anzusehen und vermittelt einen Hauch von Anarchie. Und genau das ist das Problem: Die Frauen, die in der realen „Sibylle“ zu sehen waren, trugen andere Kleidung, unterlagen nie der Schwulen-Ästhetik. Auch was sie trugen, war besonders. Es gefiel. Frau erhielt Schnittmusterbögen vom einen oder anderen Kleidungsstück. Denn zu kaufen gab es diese selbstbewusst-lässige Garderobe nicht.
Und an dieser Stelle sehe ich einen möglichen Paradigmenwechsel: Es kommt überhaupt nicht mehr darauf an, sich der gelebten Wirklichkeit in der DDR anzunähern, den Versuch zu machen, „authentisch“ zu sein. Die Leiche „DDR“ wird immer noch gefleddert, aber nun dient sie nur noch als Projektionsfläche für Sehnsüchte der heutigen jungen Generation. Ästhetisch gehört die gezeigte Szene eher nach Kreuzberg als nach Ostberlin. Extrovertierte Selbstdarsteller. Gewiss, es gab in (Ost-)Berlin eine künstlerische Szene, wie in Leipzig auch. Aber ihre Protagonisten waren in erster Linie Literaten und Maler. Und diese kleideten sich manchmal individuell, meist aber in der Nonkonformisten-Uniform Jeans, Parka, Wollrolli – alles gern auch aus dem Westen. Weder die Sibylle-Frauen noch die Künstler frönten einem solchen dauereuphorischen Narzissmus. Lediglich die Null-Bock-Punker ergingen sich in Style- und Outfit-Orgien wie im Film dargestellt. Die andere Seite der DDR jenseits von Politik und Stasi zu zeigen ist löblich, aber dieser Film hat ein Märchenland als Kulisse und nicht die DDR.
Paradies für Unangepasste
Zu erklären ist diese Verklärung wohl mit dem gegenwärtigen katastrophischen Zustand, in dem Deutschland sich befindet: Es gab einmal ein Paradies für Unangepasste. Und das lag in der DDR. Die litt zwar politisch an Schwachsinn, war aber auch ein Ort von beglückend traumhaft-taumelndem Lebensgefühl, wenn man es nur wollte – so die Behauptung. Kommune 1 in Ostberlin in den 80er Jahren.
In der Tat: Es gab Möglichkeiten, anders zu leben, als es vorgeschrieben war. Es gab Nischen und kleine Parallelstrukturen. Es gab die kleine Freiheit in der großen Unfreiheit. Aber sie prägte nicht das große Ganze. Sie wurde toleriert (in den 80ern eher als in den frühen Jahren) und stand unter Beobachtung. Und sie war nicht so glamourös und dauerekstatisch wie der Film es suggeriert. Fast jeder ging einer Arbeit nach, 43 Stunden die Woche. Ausflippen konnte man nur in der Freizeit (die beruflichen Künstler ausgenommen). Auch die Studenten waren für irre Ekstasen viel zu brav und strebsam.
Also: Von 17 Millionen Spießern (DDR-Bürgern) sind 5 Millionen Stasispitzel und – seit Neuestem – 6 Millionen Hippies und Künstler. Was für ein Erkenntnisgewinn nach über dreißig Jahren! Der Ossi bleibt der große Unbekannte. Das macht ihn weiterhin anschlussfähig für Projektionen aller Art und Güte. Man darf neugierig bleiben: Wer ist der nächste Held oder Anti-Held? Wie wäre es denn einmal mit den Bauern und ihren LPGs?
Über den Beitrag und die Autorin
Dieser Beitrag wurde am 21. Oktober 2022 auf der Plattform TUMULT – Vierteljahresschrift für Konsensstörung erstveröffentlicht. Die Redaktion des Online-Handbuchs bedankt sich bei der Autorin für die Zustimmung zur Zweitveröffentlichung.
Über die Autorin
Beate Broßmann, 1961 in Leipzig geboren, erfolgreiches Philosophie-Studium, vor der „Wende“ in der DDR Engagement für demokratische Reformen, später Mitglied der oppositionellen Vereinigung „Demokratischer Aufbruch“.
Seit 2018 Autorin bei www.anbruch-magazin.de.
Empfohlene Zitierweise